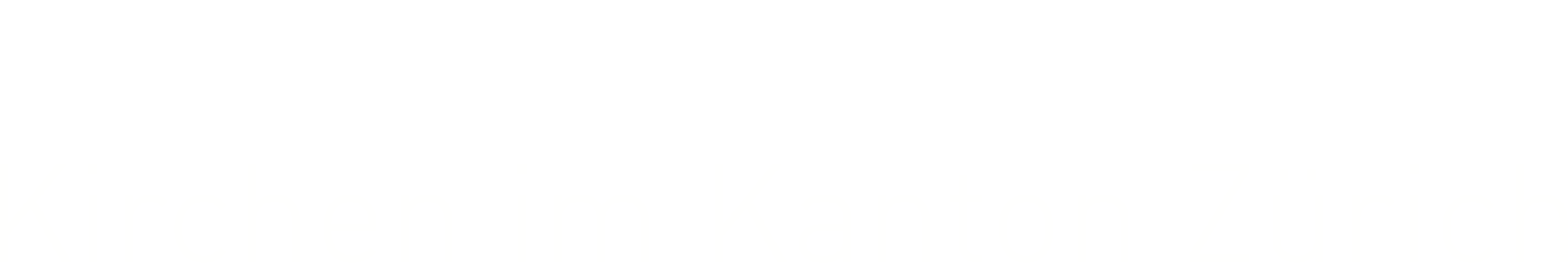Aus welchen Gründen sind Sie Mitglied der Jury für den kirchlichen Filmpreis geworden?
Ich habe mehrere wissenschaftliche Artikel über Religion und Film publiziert und einen Sammelband über die Passionsgeschichte in der Kultur mit Fokus auf filmische Darstellungen mitherausgegeben. Zudem hatte ich bereits die Gelegenheit in zwei Film-Jurys (in Locarno und Fribourg) mitzuwirken. Und – falls das noch nicht klar sein sollte: Ich mag Filme!
Welche Kriterien zeichnen für Sie persönlich bzw. Ihrer Ansicht nach einen preiswürdigen Film aus?
Ein guter Film hat eine Signatur, erschafft etwas Neues, kombiniert auf unerwartete Weise Genres, Styles und filmsprachliche Elemente. Ein guter Film ist subversiv, unbequem und kritisch. Ein guter Film ist schön, lustig, traurig, skurril, einfach und kompliziert.
Welches ist Ihr persönlicher Lieblingsfilm aller Zeiten?
Diese Frage ist einfach unbeantwortbar. Ich habe zu viele Lieblingsfilme. Ich kann hier frei, assoziativ und ohne Systematik einige auflisten: Lazzaro Felice (Alice Rohrwacher, 2018); The Wild Bunch (Sam Peckinpah, 1969); Amarcord (Federico Fellini, 1993); After Hours (Martin Scorsese, 1985); Blade Runner (Ridley Scott, 1982); Cul-de-sac (Roman Polansky, 1966); Il buono, il brutto, il cattivo (Sergio Leone, 1966) ; Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto (Lina Wertmüller, 1974), Brazil (Terry Gilliam, 1985); Corpus Christi (Jan Komasa, 2019), Shichinin no samurai (Akira Kurosawa, 1954), Land and freedom (Ken Loach, 1995), Laitakaupungin valot (Aki Kaurismäki, 2006), Down by law (Jim Jarmusch, 1986), El ángel exterminador (Luis Buñuel, 1962); La Ricotta (Pier-Paolo Pasolini, Episode aus Ro.Go.Pa.G., 1993), El Topo (Alejandro Jodorowsky, 1970).